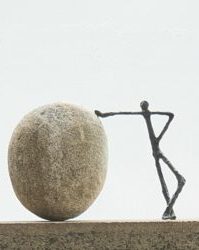Aktuell und anzunehmenderweise auch für die nächsten Jahre, wird die Beschaffung geeigneter Mitarbeiter die kardinale Frage im Bereich Personal darstellen[1]. Dabei ist der, in letzter Zeit häufig zu hörenden, Ansatz einer mehr freizeitorientierten Generation Z (oder deren Vorläufer, X&Y) eher weniger geeignete eine Lösung für das Problem und den Umgang mit jüngeren, mittelalten Mitarbeitern zu liefern.
Das Thema der „Jugend“ oder der „Jungen“, als vermeintlich oder real weniger leistungsfähigem Teil der Bevölkerung ist keine Erfindung der Neuzeit. Dem Thema geht die Welt zumindest seit den Zeiten der Sumerer[2] nach. So kann man denn auch Sokrates und Platon zitieren, die meinten,
„Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer“ (Sokrates, 470-399 v.Chr.)
„Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. (Sokrates, 470-399 v.Chr.)
„[…] die Schüler achten Lehrer und Erzieher gering. Überhaupt, die Jüngeren stellen sich den Älteren gleich und treten gegen sie auf, in Wort und Tat“ (Platon, 427-347 v. Chr.)[3]
..(auf die Frage an einen Vater, warum er seiner Tochter nicht den gewünschten Porsche kauft) ..meine Tochter möchte da anfangen wo ich aufgehört habe, ohne die Vorleistung zu erbringen (Zitat eines Mandanten in den 80ern, GHP).
Offensichtlich reicht also die Tatsache einer gewissen Renitenz, einer Art von Respektlosigkeit oder eine Neigung zu einer – neudeutsch formuliert – work-life balance[4] nicht aus, um den Kandidaten den Stempel „leistungsunwillig“ oder „freizeitorientiert“ aufzudrücken. Wenn diese Ansicht in der Welt schon seit tausenden Jahren existiert und die Beurteilung sich fortschreibt, muss es ein Umstand sein, mit dem man gelernt hat umzugehen. Und das muß eben auch die heutige Gesellschaft.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Diskussion der Arbeitszeitverkürzung. Die kennen wir im besonderen Maße seit den 80er und nun wieder verstärkt in bestimmten Bereichen[5], aber eben auch allgemein in der Großindustrie, dem Mittelstand bis zu kleineren Handwerksbetrieben[6].
Offensichtlich ist die 60 Stundenwoche[7] nicht mehr im Fokus der arbeitenden Bevölkerung (und eben nicht nur der sogenannten Generationen X, Y & Z). Wenn es aber ein allgemeiner Zeitgeist ist, kann das die Suche nach einer Lösung für das Problem der Beschaffung der richtigen Mitarbeiter signifikant beeinflussen. Dann ist der Focus mehr auf die ermittelten Ursachen in der Breite der arbeitenden Bevölkerung zu legen und nicht auf die trendigen Fragen nach der Ausrichtung der Generationen X, Y, & Z.
Identifizierbar ist vielleicht in erster Linie eine allgemeine Verringerung der Frustrationstoleranz und das im Besonderen bei eben diesen vermeintlich richtig identifizierten Generationen. Eine Lebenseinstellung wohl auch unterstützt durch den eigenen (Lebens-)Erfahrungshintergrund, der eher weniger existentielle Fragen aufwarf als bei der Generation der Babyboomer[8]. Aber eben nicht nur bei diesen Generationen, sondern auch bei Menschen, die in den 60ern geboren sind. Die Ursache hat vielfältige Gründe. Summerhill’s Antiautoritarismus, Helikopter Eltern und eine Tendenz zur Überfürsorglichkeit, die den Alltag der jüngeren Generationen seit den späten 60ern heimsuchte, dürften ihren Anteil daran haben.[9]
Gerade die geminderte Frustationstoleranz dürfte ein Ansatzpunkt sein, den es lohnt weiterzuverfolgen. Aus ihr ergibt sich wahrscheinlich auch die besondere Wechselbereitschaft vieler Leistungsträger. Im Umkehrschluss sollte es also bei der Recrutierung und Führung darauf ankommen die Leistungsanforderungen so zu tarieren, dass eine schrittweise Adaption möglich ist und in der Akquisition einen Ductus zu finden, der diesen Aspekt auch vermittelt.[10]
Inwieweit die allgemein diskutierten Aspekte der Generationen/Kohorten X, Y, & Z prägenden Einfluss auf eine Beurteilung haben oder nicht vielmehr implizit auch Ausdruck einer gesellschaftlichen (Gesamt-)Einstellung widerspiegelt[11], muß man sich fragen.
Daran wären vielleicht auch einzelne Maßnahmen im Rahmen der Mitarbeiterakquisition anzuknüpfen.
Trotzdem muss man die Analyse der Generationen nicht außer Acht lassen. Als ein Beispiel für eine verbreitete Sicht auf die Generationeneinteilung:
Statt Vieler Boris Kasper:
.. Generation Y. Sie wurde stark emanzipiert, sehr fürsorglich und extrem wertschätzend erzogen. Sozusagen in die Wiege gelegt wurde ihr die ständige Einladung zur Mitbestimmung und Teilhabe: An ihrer Erziehung, in den aufkommenden sozialen Medien – und auch durch gesellschaftliche Megatrends wie soziale und Gender-Gleichstellung, globale Vernetzung und die Digitalisierung. Weil sie als erste Generation von Anfang an in einer digitalisierten Welt aufgewachsen ist, wird die Generation der Ypsiloner auch Digital Natives genannt. Genau diese positive (Aufbruch-)Stimmung der Industrie- und Erlebniswelt 4.0 mit ihren unzähligen Partizipationsmöglichkeiten und der Verheißung, alles sein nun möglich, hat diese Generation zu besonderen Optimisten gemacht. Sie möchte ihre Welt spielerisch und möglichst frei mitgestalten.
Die … Generation Z. Auch sie wurde mit großer Wertschätzung erzogen, allerdings hat sich die Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu einer Überfürsorglichkeit gesteigert – Stichwort Helikopter-Eltern. Während sie daheim also allzu gut behütet aufwuchsen, prägten sie von außen gleichzeitig die Bedrohungen von Klimawandel und Terror sowie auch sich wieder verhärtende und ausgrenzende politische und gesellschaftliche Agitation. Statt der glorreichen digitalen Auf- und Umbruchstimmung erlebten sie bereits die ersten Schattenseiten der Digitalisierung, auf den sie mit bewusstem Teilverzicht und einer teilweisen Rückbesinnung auf traditionelle Medien reagieren. Die Gen Z – sie hat erkannt, dass die versprochene digitale sowie auch die gesellschaftliche Teilhabe oftmals nur Illusion geblieben sind. Das hat sie zu äußerst kritische Realisten gemacht. Ihre scharfe Weltsicht gemischt mit der überfürsorglichen Erziehungsprägung führt zu ihrem starken Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität.
- Anspruch an Arbeitswelt: Work-Life-Blending versus Work-Life-Separating Die Erwartung an gelebte Freizeit unterscheidet Generation Y und Gen Z wesentlich
Der Generation Y sind statt Statussymbolen und Gehalt eine intensiv gelebte Freizeit und die Option, diese flexible einzuteilen, wichtig. Darum wünscht sie sich ebenso flexible Arbeitsmodelle. Sie strebt nach Selbstverwirklichung und will sich im Job persönlich einbringen. Die Generation Y erwartet von ihrem Arbeitsplatz, dass sie dort berufliche und private Interessen sowie eigenen Werte leben kann: Sie will ihr Leben nicht von der Arbeit trennen – sondern in Work-Life-Blending, dem Vermischen von persönlicher Frei- und beruflicher Arbeitszeit, in einander übergehen lassen. Darum ist ihr Arbeit wichtig, die Sinn hat und so ihrem Sein Sinn gibt. Die visionäre Sinnsuche und der Ehrgeiz, selbstbestimmt die besten Lösungen zu entwickeln, ist charakteristisch für die Genration Y.
Auch der Generation Z ist ihre lebenswerte Freizeit äußerst wichtig. Doch anders als die Generation Y möchte sie Freizeit nicht mal hier, mal dann zwischen der Arbeit erleben, sondern möglichst weit und klar von der Arbeitszeit abgrenzen: Die Gen Z möchte nicht flexibel arbeiten, sondern im Gegenteil zeitlich sowie inhaltlich strukturiert. Aus Work-Life-Blending macht sie ein striktes Work-Life-Separating. Von ihrem Arbeitsplatz erwarten sie darum eine klare Trennung von privatem Leben und Beruf sowie verbindliche Freizeit-Regelungen. Selbstverwirklichung sucht sie nicht im Arbeitsleben, dennoch soll auch für die Gen Z der Job zu ihren individuellen Fähigkeiten sowie Werten passen. Auch für sie spielt Sinnhaftigkeit eine große Rolle – nur möchte sie diesen Sinn im Job nicht zwingend selbst suchen, sondern nachvollziehbar erklärt bekommen.
- Leistung und Motivation: Teilhabe versus Zuteilung
Ein anderer Wille nach Teilhabe gehört zu den Unterschieden zwischen Generation Y und Gen Z
Die Generation Y fordert von ihrer Arbeitswelt sowie von ihrer Führung in hohem Maße Teilhabe, also Mitbestimmung und -gestaltung: an Prozessen, Strategien und Zielen – und den dafür optimalen Lösungswegen. Sie lehnt feste Strukturen ab und will sich stattdessen in möglichst agilen Teams und in flexibler Projekt-Arbeit selbst organisieren. Dafür braucht sie eine hierarchielose Atmosphäre, den Expertenaustausch auf Augenhöhe und Leadership, das sie zum Bestmöglichen empowert. Die Generation Y wünscht sich Kollegialität und familiären Team-Spirit: Das und ihre persönliche Entwicklung sind ihr wichtiger als bloßer Karriere-Aufstieg.
Derartige Beschreibungen sind relativ und das muss man bei der Analyse berücksichtigen. Ob man seine persönliche Biographie danach orientiert Arbeit & Privates in einem ausgewogenen Verhältnis zu halten oder Phasen intensivster Arbeit vor- oder nachgelagert zu privateren Zeiten gestaltet, Arbeit als Beruf und/oder Berufung betrachtet oder philantrophisch der Kunst, der Familie den hauptsächlichen Teil seiner Zeit widmen will, entscheidet die betreffende Person. Im Gegensatz zu den 70er (oder früher) ist der Ductus der Gesellschaft insgesamt auf eine offenere und primär auf Selbstentscheidung basierende Gestaltung hin orientiert und damit im Ergebnis vielfältiger. Aber nicht anders. Die Selektion der Typologien von Mitarbeitern und das Auffinden ist schwieriger und in einer Übergangsphase durch die Anzahl der Nachfrager beschränkt. Gerade in diesem Zusammenhang sind Hilfsmittel zur Analyse, Förderung und Führung von Mitarbeiter (auch eine KI) ein überlegenswerter Lösungsansatz. Die Vielfalt der Lebensentwürfe (die hatten wir früher auch, spätestens nach Einstellung und als passive Leitlinie) sind nicht das Problem, sondern die Lösung[12].
Jedes Unternehmen muss seinen Bedarf finden, identifizieren und darauf ausgerichtet für den Markt ein Konzept der Selbstdarstellung entwickeln. Das kann und darf nicht nur auf die Generationenkategorisierung ausgerichtet sein, sondern sollte auch andere gesellschaftliche Gruppen – z.B. die „Früh“Rentner, silver liner – mit einbeziehen und motivieren. Und das sollte man nicht als schon bekannte Platitude betrachten sondern als Auftrag an die Unternehmen detaillierte Maßnahmen zu erarbeiten, um die richtigen Zielgruppen anzusprechen und zu motivieren. Und man sollte sich nicht auf das vermeintlich offensichtliche der Generationsfrage beschränken, sondern den gesellschaftlichen Zustand in Bezug auf die Frage von Arbeit, Leistung und Beruf(ung) beachten.
[1] Das ist bereits seit Längerem so, wird sich aber noch verschärfen.
[2] Dieser historische Ausflug sei hier erlaubt.
[3] Wenn es interessiert u.a. (mit weiteren Hinweisen auch auf Aristotels und eben die Sumer), https://bildungswissenschaftler.de/impressumurheberrecht/
[4] Etwas das wir alle wohl mehr oder minder schon einmal durchdacht haben, teilweise auch leben und das den Altvorderen auch nicht unbekannt gewesen sein dürfte und das sich in letzter Zeit wieder in die andere Richtung dreht
[5] Das gilt nicht nur für die Lokführer der GDL, sondern findet sich auch bei vielen anderen kleinen und großen mittelständischen Unternehmen. Wir haben in den 80er + 90er selber das Angebot eine anderen Arbeitsstruktur (z.B. 4 x 10 Stunden, ein Tag frei; ab den 90er auch zusätzlich ein oder zwei Tage Home Office) in unseren Unternehmen und mandatierten Unternehmen mit einigem Erfolg praktiziert.
[6] Unlängst reüssierte ein Fensterbauer mit 20 Mitarbeitern mit der 4 Tagewoche bei vollem Lohnausgleich.
[7] Dessen Minimierung war selbstverständlich nicht nur in den 50er ein legitimer Anspruch und die Tatsache, dass auch in der Generation Z genauso viele Burn Outs trotz oder wegen der Work-Life-Balance eben dieser Generationen gibt.
[8] Interessante Lektüre zu diesem Thema: Bude, Abschied von den Boomern
[9] Im Grunde ist die Ursache nur zweitrangig, kann aber helfen die Methoden zu entwickeln die Mitarbeiter an diesem Punkt abzuholen.
[10] Ebenso wie bei vorangehenden Generationen sind die Kriterien der Berufswahl variant. Pekuniäre Interessen finden sich dort ebenso wie die Ansicht, dass ein Beruf auch Berufung sein kann, es kommt als darauf an zielgruppenkonforme Darstellungen zu finden.
[11] Meiner Meinung nach hat sich das Rekurrieren „auf ein bestehendes oder behauptetes Recht auf Teilhabe und Versorgung“ in den letzten Jahrzehnten nachhaltig vermehrt. Ein Ausdruck von Menschen, die Verantwortung eher abgeben wollen, als wahrnehmen.
[12] Vielleicht ein wenig weit hergeholt: aber ein ähnliches Thema hatten wir in der sich entwickelnden Automatisierung und daran anschließend der „Fertigung auf Bestellung“ und deren Einspeisung in die Produktion.